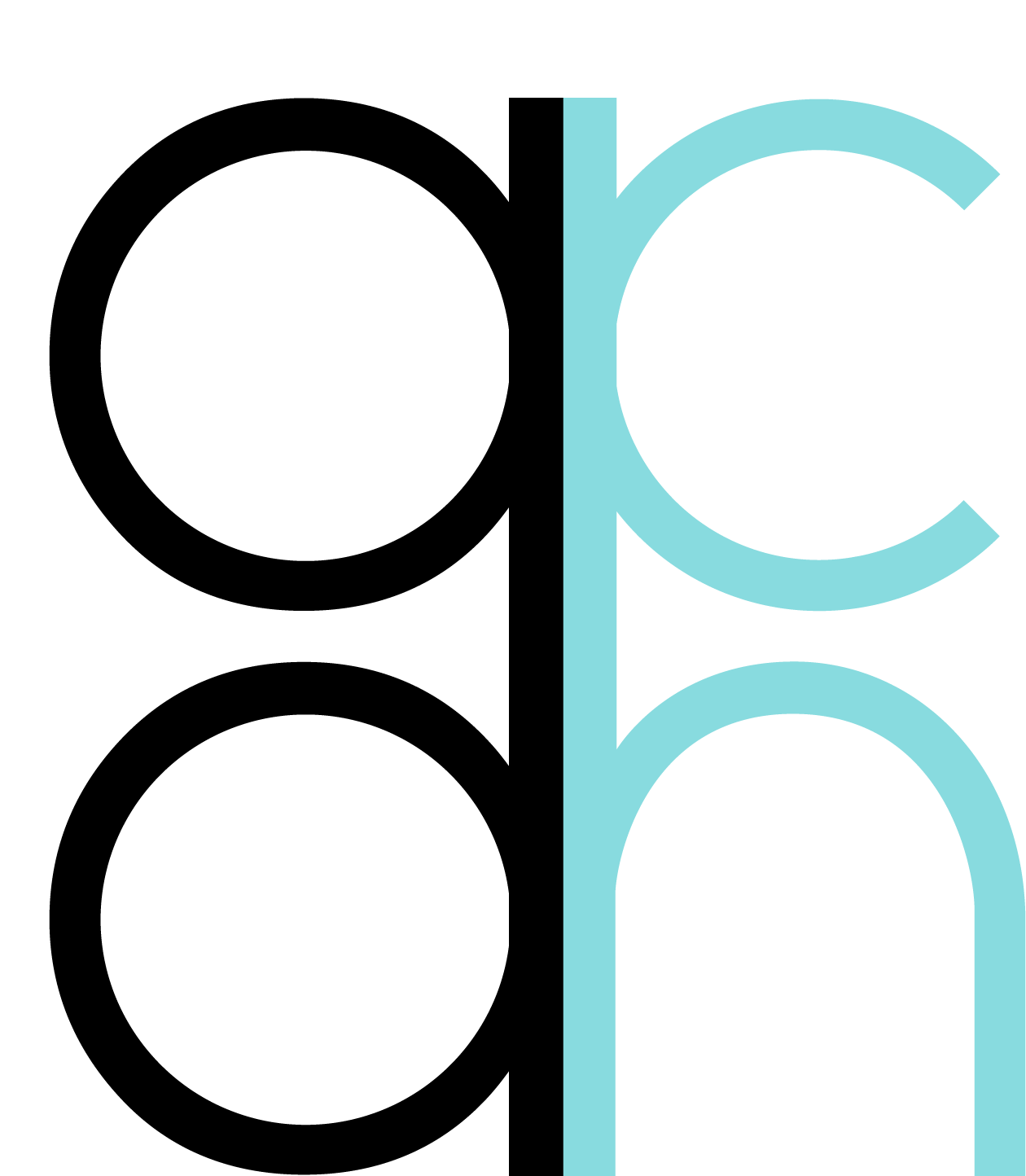Symphonie
(Sinfonie)
Bezeichnung für die zentrale Gattung der autonomen Orchestermusik im 18./19 Jh. (frz. simphonie, symphonie, ital. sinfonia, engl. symphony); aus dem griechischen syn (zusammen) und phōnē (Klang). In Übereinstimmung mit dieser aus der Antike überlieferten Bedeutung „Zusammenklang“, „Übereinstimmung“, „Harmonie“ wurde der Begriff S. im Mittelalter für die Intervalle Quarte, Quinte und Oktave, darüber hinaus für Musikinstrumente (Drehleier), Gesang oder bis ins 15. und 16. Jh. für Musik im Allgemeinen verwendet. Auch die um 1600 wiederholt auftretende Bezeichnung Symphoniae sacrae bzw. Sacrae symphoniae (vgl. G. Gabrieli, 1597, Heinrich Schütz, 1629, 1647, 1650) ist noch nicht als ausschließliche Bezeichnung für autonome Instrumentalmusik (absolute Musik) zu verstehen. Ähnlich enthalten die Ecclesiastiche sinfonie (Venedig, 1607) von Adriano Banchieri (1568–1634), im Musikalieninventar des Bischofs Johann Jakob von Lamberg in Gurk aus dem Jahr 1622 angeführt, sowohl Motetten als auch Instrumentalkanzonen.Die Sinfonia als Bezeichnung für ein reines, oft auf dem Vorbild der Canzone basierendes Instrumentalstück (im Sinne von „Zusammenspiel“; einleitende Instrumentalsätze oder Ritornelle), das sich in Italien nach 1600 (Claudio Monteverdi, Orfeo 1607) und nach 1640 v. a. in den deutschsprachigen Ländern durchsetzte, resultiert einerseits aus der Entwicklung des Instrumentenbaus und -spiels, andererseits aus der Entstehung des typisierten fünf- (Jean-Baptiste Lully) und danach vierstimmigen Satzes (Alessandro Stradella). Da jedoch weder die Besetzungen noch die Anzahl der Stimmen zunächst einer bestimmten Norm unterworfen waren, wurde die Bezeichnung S. bis um 1700 sowohl für Triosonaten als auch mehrsätzige Ensemblestücke verwendet, mit dem entsprechenden Alternieren zwischen Sonata und Sinfonia. Von A. Caldara etwa ist aus der Zeit um 1700 eine Sinfonia à Violoncello solo mit Basso continuo überliefert; seine Sinfonia concertata (EM 116) stellt ein Concerto für zwei Violinen und Continuo dar.
Besonderen quantitativen Aufschwung erlebte die S. als instrumentaler Einleitungssatz in musikdramatischen Formen (Oper, Oratorium, Kantate), mit P. F. Cavalli in Venedig/I, M. A. Cesti in Venedig und Wien, Carlo Pallavicino in Venedig und Dresden/D im Vordergrund. Obwohl sich die italienische Opernsinfonia durch eine verwirrende (durch lokale Traditionen sowie Möglichkeiten bedingte) Formen- und Lösungsvielfalt auszeichnete, steht hier die zweiteilige Form mit einem langsamen, erhabenen homophonen Satz zu Beginn und einem darauf folgenden schnellen Satz mit Tanzcharakter als den wichtigsten Charakteristika im Vordergrund. Die dreisätzige Form mit dem Schema schnell – langsam – schnell, die dem Anschein nach auf A. Scarlatti (Tutto il mal non vien per nuocere, Rom 1681) zurückzuführen ist, wurde erst nach 1700 zunehmend zur Regel.
Nach dem italienischen Vorbild wurden auch in der Wiener Oper als S. entweder die instrumentalen Einleitungssätze (ähnlich auch Intrada, Preludio oder Entrèe, Sinfonia oder Ouverture) oder aber selbständige Instrumentalsätze (wie auch Preludio oder Sonata) bezeichnet (z. B. G. Bononcini, Li Sagrifici di Romolo per la Salute di Roma, 1708, oder häufig bei A. Caldara, Ifigenia in Aulide, 1718, Gianguir, 1724, Semiramide in Ascalone, 1725, Enone, 1734, u. a.). Anders als im 17. Jh. wurden um 1700 die instrumentalen Einleitungssätze bereits als fester Bestandteil der Oper direkt in die Opernpartitur inkludiert. Obwohl die Anzahl der Sätze, ihre Länge sowie die Art der Übergänge sehr variabel (die Sinfonia zu J. J. Fux’ Gli Ossequi della Notte, 1709, aus sechs Sätzen bestehend) gestaltet wurde, gewinnt die Dreisätzigkeit nach dem Schema schnell – langsam – schnell (mit einem Tanzsatz, am häufigsten einem Menuett, als Schlusssatz), auch in Wien zunehmend an Bedeutung. Die Sinfonia zu F. Contis Archelao Rè di Cappadocia (1722) enthält sogar zwei Menuette, wobei das erste nach dem Schema A-B-A wiederholt wird.
Die terminologische Abgrenzung zwischen Sinfonia und Ouverture verläuft aufgrund der um 1700 charakteristischen Vermischung der beiden Formen oft nur undeutlich: Noch in der Sinfonia aus dem Dialogo tra Minerva ed Apollo (1728) ersetzte G. Reutter d. J. den schnellen fugierten Teil der französischen Ouverture durch eine Fuga. Nicht zuletzt tragen die instrumentalen Einleitungssätze gelegentlich die alternierenden Bezeichnungen Ouverture bzw. Sinfonia (z. B. Orfeo ed Euridice 1715, 1728). Im Gegensatz zur Ouverture, die in Übereinstimmung mit der Zeitkonvention vermehrt von solistischen Blasinstrumenten (Oboen, Hörner) oder Bläsertrio mit zwei Oboen und Fagott Gebrauch machte, zeichnet sich die S. in der Wiener Oper durch intensive Anwendung der Concerto grosso-Technik nach römischem Vorbild sowie die richtungweisende Bevorzugung des vierstimmigen Streichensembles mit verstärkenden Oboen und Fagotten aus. In den mittleren Sätzen wurden die Oboen und Fagotte oft weggelassen. Nach 1716 wurde diese vierstimmige Besetzung oft durch Trompeten und Pauken erweitert, darüber hinaus ist für die S. in der Wiener Oper das doppelchörige Prinzip charakteristisch, das sowohl in den Einleitungssätzen (J. J. Fux, Gli Ossequi della Notte 1709, und Enea negli Elisi 1731, A. Caldara/G. Reutter, La Forza dell’amicizia1728, u. a.) als auch in selbständigen Instrumentalsätzen angewendet wurde (so ist etwa die doppelchörige Sinfonia con Trombe, e Timpani, e Istrum[en]ti aus Caldaras I due Dittatori, 1726, V. Akt, zugleich das einzige Beispiel für das doppelchörige Prinzip in dieser Oper). Die Besetzung mit Hörnern, in Italien um und nach 1720 typisch, bildete in Wien dagegen eine Seltenheit. Von den Ouverturen mit Corni da caccia in M. A. Zianis Meleagro 1706, G. Bononcinis Endimione oder A. Bononcinis Tigrane Rè d’Armenia 1710 abgesehen, finden sich Hörner nur in der Sinfonia zu Artaserse (1730) von L. Vinci. Diese Sinfonia stellt zugleich den Typus der dreiteiligen Opernsinfonia neapolitanischer Richtung dar, wie sie in Italien durch F. Feo, L. Leo, N. Porpora, G. B. Pergolesi, G. B. Sammartini präsentiert wurde, mit vierstimmigem homophonem Satz, charakteristischer Dreiklangsmotivik und verlangsamtem harmonischem Ablauf, einem Siciliano als Mittelteil und Menuett oder Gigue als letztem Satz, mit harmoniefüllenden Blasinstrumenten (Oboen, Hörner) sowie Akzent auf massivem, homogenem Klang als vorherrschenden Merkmalen. Nach Vinci wurde diese Stilorientierung, wenn auch durch die spezifische Wiener Tradition modifiziert, v. a. durch J. Bonno (z. B. die S. zu La Generosità di Artaserse 1737, Il Natale di Numa Pompilio 1739) sowie L. A. Predieri (Gli Auguri Spiegati 1737) fortgesetzt.
In Zusammenhang mit der steigenden Bedeutung der reinen Instrumentalmusik wurden diese Einleitungssätze selbständig aufgeführt, wie die Sinfonia zu F. Contis Pallade Trionfante (1722), die als Instrumentalstück in einer Kopie in A-Wn mit Aufführungsdaten von 1748 bis 1753 vorliegt. Ähnlich stellen die zwölf Sinfonien von A. Caldara, die als Sinfonien bzw. Sonaten in zeitgenössischen Abschriften in A-Wn und A-Wgm vorliegen, instrumentale Einleitungssätze (Introduzioni) zu seinen Oratorien aus der Zeit zwischen 1718 und 1735 (Il Martirio di S. Terenziano 1718, bis La Passione di Gesù Signor nostro 1730, Sinfonia Nr. 12) dar.
Die Anfänge der sog. Konzert-S., die aus dem wachsenden Bedarf des privaten und öffentlichen Konzertbetriebs resultierte, sind wahrscheinlich auf G. B. Sammartini zurückzuführen, der in der Zeit zwischen ca. 1730 und 1750 in Mailand/I nach dem Vorbild der italienischen Triosonate und des Concerto ripieno eine neue Gattung für das Konzert im adeligen und später bürgerlichen Rahmen schuf. Konnte sich die S. in Italien aufgrund der starken Bevorzugung des instrumentalen Solokonzertes und der Kammermusik nicht wirklich durchsetzen, verbreitete sich diese Gattung, durch die rasche Entwicklung des öffentlichen Konzertwesens und das ausgereifte Verlagswesen entschieden begünstigt, mit großem Erfolg in ganz Europa, v. a. aber in Frankreich (Paris), England (London), Deutschland (Berlin, Darmstadt, Mannheim) und – etwas verzögert – in Österreich. Das für diese Zeit charakteristische Fehlen von ausgereifter spezifischer Orchesteridiomatik sowie die übliche vierstimmige Standardbesetzung für zwei Violinen, Viola und Basso continuo ohne Bläser führten in Verbindung mit dem Argument der besseren Verkäuflichkeit dazu, dass die frühen S.n sowohl solistisch als auch chorisch aufgeführt werden konnten (z. B. Six sonates à trois parties concertantes qui sont faites pour exécuter ou à trois, ou avec toutes l’orchestre, op. 1, von J. Stamitz, 1755/56). Betonte schon Jens Peter Larsen (1994), dass in Bezug auf die potenziellen „Wegbereiter-Werke“ für die Entwicklung J. Haydns auf dem Gebiet der sinfonischen Musik „eine Beschränkung auf die ausdrücklich als ‚Symphonie‘ oder ‚Sinfonia‘ bezeichneten Werke […] aufgrund gegenseitiger Vermischung und Beeinflussung mehrerer Gattungen […] nicht angängig ist“, wurde bisher zuwenig Beachtung der Entwicklung des Orchesterspiels geschenkt, wie sie in den orchestralen Begleitstimmen der italienischen Oper in Wien bis 1740 stattfand.
Wie die Entwicklung der S. in Mannheim (Carl Joseph Toeschi, Anton Fils, Johann Christian Cannabich, C. Stamitz) belegt, hängt die weitere Entwicklung dieser Gattung eng mit jener des Orchesters, des spezifischen Orchesterstils und nicht zuletzt auch der Orchesterdisziplin zusammen. Praktisch gleichzeitig mit der Etablierung der fast ausschließlich dreisätzigen, sowohl formal, als auch melodisch und harmonisch klar organisierten S. des C. Stamitz (über 50 S.n der Zeit gegen 1770 bis 1791) wurde in Wien im Umkreis des Wiener Hofes und der adeligen Kapellen (W. R. Birck, F. I. A. Tuma, K. Kohaut, M. G. Monn) sowie in Salzburg (L. Mozart, J. E. Eberlin) und Innsbruck (J. E. Sylva) sowohl die Sinfonia a quattro als auch a tre nach dem Vorbild der italienischen Opernsinfonia und der Konzert-S. gepflegt, mit dem Menuett (meist an dritter Stelle) als einem der hervorstechenden Merkmale. Die Trennung der italienischen Opernsinfonia von der Konzert-S. wurde von G. Ch. Wagenseil vollzogen (ca. 90 S.n, dessen Werke weit über die Grenze des Habsburger-Imperiums große Akzeptanz erlebten; vgl. etwa den 1756 in Paris erschienenen Druck La Melodia Germanica mit S.n von Stamitz, Richter, Wenzel Kohaut und Wagenseil). Anders als in Italien oder Deutschland (bis auf die Hofkapelle der Fürsten von Oettingen-Wallerstein mit A. Rosetti) erreichte diese Gattung nach der ersten Aufführung einer Sinfonie von Stamitz in den Concerts spirituels 1751 und insbesondere ab 1760 in Paris (François-Joseph Gossec), London (Carl Friedrich Abel, J. Ch. Bach) und Spanien (Luigi Boccherini) ungeahnte Akzeptanz. V. a. in den habsburgischen Ländern, in der Hauptstadt Wien sowie in zahlreichen Klöstern (Klosterkultur), Bischofs- und Sommerresidenzen, mit Komponisten wie F. L. Gaßmann, C. d’Ordonez, J. Starzer, M. Haydn, Leop. Hofmann, J. B. Vanhal, C. Ditters v. Dittersdorf, V. Pichl, L. A. Kozeluch, I. Pleyel mutierte die S. um und nach 1770 neben dem Streichquartett allmählich zur wichtigsten Gattung der Instrumentalmusik. Besonderer Vorliebe erfreute sich neben der für den Kirchengebrauch bestimmten, meist einsätzigen Kirchen-S. als eine Fortsetzung der Sinfonia da chiesa auch die Programmsymphonie, die aus den erweiterten Ausdrucksmöglichkeiten der Orchesterbesetzung und der Ausarbeitung der v. a. aus der barocken Oper stammenden Orchestereffekte wie Jagdszenen (vgl. Haydns Symphonie Hob. I:73 La Chasse), Stürme, Gewitter, Schlacht, Militär u. ä. sowie der Übernahme des pastoralen Topos resultierte (z. B. die Ovid-S.n von C. Dittersdorf oder noch die S.n L. Spohrs wie etwa die S. Nr. 4 op. 86 Die Weihe der Töne, 1832).
Während die S.n Mozarts, mit der Pariser S., KV 297, 1778, der Haffner-S. KV 385, 1782; der Linzer S. KV 425, 1783, der Prager S. KV 504, 1786, und den letzten S.n Es-Dur KV 543, g-Moll KV 550, C-Dur, Jupiter, KV. 551, 1788, im Vordergrund, trotz ihrer enormen künstlerischen Qualität zu Lebzeiten des Komponisten nur relativ wenig verbreitet waren, erreichten die 104 S.n J. Haydns (v. a. die Pariser S.n Hob. I:82–87, 1785/86, und die 12 Londoner S.n, Hob. I:93–104, 1791/92 und 1793–95) als Typus der großen Konzert-S. große Akzeptanz bei den unterschiedlichen Publikumsschichten. Das Heranwachsen der S. zum zentralen Objekt der Konzertprogramme hängt mit der Vergrößerung der Orchester sowie dem Aufbau des Instrumentariums (Teilung und Verselbständigung der Bläserstimmen), und, wie neben J. Haydn auch bei Wagenseil zu beobachten, mit der kontinuierlich anwachsenden Länge der Sätze zusammen.
An diese herausragende Stellung der S. knüpfte L. v. Beethoven an. Obwohl seine neun S.n (1799–1824) bis auf die Nr. 6 Pastorale viersätzig sind, mit einem Scherzo anstelle des Menuetts, und mit dem üblichen Charakter der Sätze bei vorherrschender Sonatensatzform, dem Verlauf der langsamen Sätze in anderen Tonarten als der Grundtonart sowie der Beibehaltung der Orchester-Standardbesetzung mit Streichern, paarweisen Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern und Pauken durchaus traditionelle Wege beschreiten, zeichnen sich sowohl der kompositorische Satz als auch die motivisch-thematische Arbeit, Dynamik, Tempo, Ausdrucksangaben oder der Umgang mit Instrumenten durch Ausloten extremer Möglichkeiten aus. Beethovens S.n prägten in entscheidendem Maße auf vielfältige Weise die künftige Entwicklung der Gattung. In Wien selbst entwickelte sich die Situation allerdings weniger günstig. Von J. H. Voříšek (S. D-Dur, op. 24) und P. Wranitzky (der oft als Dirigent von Beethovens Werken auftrat) abgesehen, erreichten die S.n von F. Krommer, A. Eberl oder A. Gyrowetz keine vergleichbare geschichtliche Bedeutung. Die S.n Fr. Schuberts (Unvollendete D 759, 1822, Große C-Dur, D 944, 1828) wurden zu seiner Zeit kaum gespielt. Neue Impulse sollten aus dem S.-Wettbewerb kommen, der 1835 von dem Wiener Konzertunternehmen Concerts spirituels ausgeschrieben wurde und den F. Lachner mit seiner von Schubert beeinflussten 5. S. c-Moll (Sinfonia passionata) für sich entscheiden konnte.
Orientierten sich R. Schumann (4 S.n, 1841–50) und F. Mendelssohn (12 frühe Streicher-S.n, 5 S. 1824–42) nach dem klassischen Vorbild, gilt die programmatisch orientierte S. fantastique (1830) von Hector Berlioz mit der sog. idée fixe, dem virtuosen Umgang mit dem Orchester und der Erweiterung der Orchesterfarben und -idiomatik als richtungweisend für die weitere Entwicklung der symphonischen Dichtung (F. Liszt, Faust-S., 1854, 1857), der Programm-S. (K. Goldmark, Ländliche Hochzeit, J. Raff, und v. a. die einsätzigen S.n von R. Strauss: Ein Heldenleben op. 40, 1897/98, Sinfonia domestica op. 53, 1901/03, und Eine Alpen-S. op. 64, 1900–15) und des symphonischen Orchesterstils überhaupt. In Wien brachte die Entwicklung der S. in den 1850er Jahren nur wenig nennenswerte Ergebnisse (z. B. vier S.n von J. Herbeck 1853–77); ohne wirklichen Erfolg blieb auch ein weiteres Preisausschreiben für neue S.n (1862). Eine Sonderstellung nehmen in diesem Zusammenhang jedoch zahlreiche S.-Bearbeitungen ein, die in Österreich sowohl in der bürgerlichen Salonmusik als auch in den Programmen der Militärmusikkapellen ihren festen Platz hatten.
Einen neuen Höhepunkt erreichte die S. bei J. Brahms (vier S.n; 1876–85) und A. Bruckner (elf S.n, 1863–96). Während Brahms in seinen S.n die deutliche Orientierung an Beethoven mit dem Heranziehen kammermusikalischer Elemente und historisierenden Mitteln verband, setzte Bruckner – unter Beibehaltung des üblichen viersätzigen Formtypus, der vorherrschenden Sonatenform, aber Verzicht auf strenge thematische Arbeit, die er durch ein Aneinanderreihen von großen Abschnitten ersetzte – den monumentalen symphonischen Stil Beethovens und Rich. Wagners fort.
Während die S. in Italien aufgrund der massiven Orientierung an der Oper nur im Hintergrund stand, erlebte diese Gattung in Frankreich eine eigenständige Entwicklung. Nach anfänglicher starker Orientierung an Haydn und danach an Beethoven entwickelten Komponisten um César Franck (S. d-Moll, 1889; Édouard Lalo, Paul Dukas, Vincent d’Indy) ein neues Formkonzept mit dem stets wiederkehrendenthème cyclique. Mit einiger Verspätung setzte die Entwicklung der S. auch in weiteren Ländern wie Dänemark (Carl August Nielsen), Norwegen (Edvard Grieg, Johann Severin Svendsen, Christian August Sinding), Finnland (J. Sibelius) ein; große internationale Bedeutung erreichten die folkloristisch gefärbten und von J. Brahms beeinflussten S.n von A. Dvořák (neun S.n) sowie Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (sechs S.n, 1868–93).
Mit G. Mahler, der in seinen zehn S.n (1888–1911) große orchestrale Besetzungen mit Chor und Soli gebrauchte und die Form auf bis zu sieben Sätzen erweiterte und (wie ansatzweise Beethoven) Vokalstimmen einbezog, erreichte die Monumentalität ihren Höhepunkt. Die Diskrepanz zwischen der auf tonalen Funktionen basierenden Form und der Atonalität, Dodekaphonie und Reihentechnik führten zur Suche nach neuen formalen Lösungen oder auch zur radikalen Ablehnung der S. So lässt sich zu Beginn des 20. Jh.s neben der Fortsetzung der spätromantischen Tradition bis zum Expressionismus (Alexander Skrjabin, H. Pfitzner, Fr. Schmidt, aber auch A. Zemlinsky, E. Krenek, H. Gál, E. Wellesz, K. Weigl, E. Toch, R. Réti, H. Kauder u. a.) auch ein mehr oder minder radikaler Bruch mit dieser Tradition bzw. ihre Umwälzung feststellen, sei es durch neoklassizistische Tendenzen (Igor Strawinsky, S. de psaumes, 1930, S. en ut, 1940, S. in drei Sätzen, 1945; Sergej Prokofjew: S. classique, 1917, aber auch Paul Hindemith, S. Mathis der Maler u. a., J. N. David, E. Krenek, S. für Blasinstrumente und Schlagwerk op. 34, 1924/25), Jazzeinflüsse (E. Krenek, Kleine S. op. 58, 1928, oder H. Jelinek, Sinfonia ritmica, 1929) oder gar die Parodie (H. Jelinek, Heitere S. für Blechbläser und Schlagzeug op. 8, 1931). Mitunter, wie bei Claude Debussy oder Béla Bartók, führte die Ablehnung der Tradition zum kompletten Verzicht auf die S. Wichtige Impulse kamen von A. Schönberg, der mit dem dodekaphonen Prinzip, in dem der fehlende, zentralisierende Grundton durch eine Grundreihe und die Sonatenhauptsatzform durch entwickelnde Variation ersetzt wurden, ein neues Organisationsmittel schuf (Wiener Schule, J. M. Hauer, H. Jelinek). Die Ablösung des tonalen Systems mit seiner formbildenden Funktion führte jedoch zunächst zur Abkehr von großen Formen sowie großen Orchesterbesetzungen (vgl. A. Schönbergs 1. Kammer-S. für 15 Soloinstrumente op. 9, 1906, rev. 1923, 2. Kammer-S. für 18 Soloinstrumente op. 38, 1906–11, 1939; F. Schreker , Kammer-S. für 23 Soloinstrumente, 1916, A. v. Webern, S. op. 21, 1928, H. Eisler, Kleine Sinfonie op. 29, 1932, aber auch E. W. Korngold, Sinfonietta B-Dur op. 5, 1912, L. Janáček, Sinfonietta, 1926). Mitunter, wie etwa in der nach Bertolt Brecht komponierten Deutschen S. (1935–39) von H. Eisler oder später die fünfsätzige Sinfonia von Luciano Berio (UA New York/USA 1968) für Orchester und 8 elektronisch verstärkte Stimmen, wurde die S. zum Träger politischer Inhalte. In den Ländern des ehemaligen kommunistischen Ostblocks, wie v. a. der Sowjetunion oder der Tschechoslowakei, wurde diese Gattung eng mit politischen Inhalten verknüpft (z. B. die S. von S. Prokofjew oder Dmitrij Schostakowitsch) oder zu ideologischen Zwecken geradezu missbraucht.
Nach der breiten, nicht zuletzt durch kompositorische Innovationen wie Serialität, Aleatorik oder elektroakustische Musik verursachten Skepsis der S. gegenüber nach dem Zweiten Weltkrieg (vgl. etwa E. Krenek) lässt sich jedoch bei Komponisten wie K. Penderecki oder Henryk Górecki in den 1970/80er Jahren als Folge der aufkommenden neoromantischen Orientierung – und nicht zuletzt als Folge der Nachfrage im Konzertbetrieb – eine deutliche Rückkehr zur S. feststellen. Zusammengefasst zeichnet sich die Entwicklung der S. durch andauernde stilistische Vielschichtigkeit, breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten, instrumentalen Mitteln sowie formalen Lösungen (Alfred Schnittke, 1.–3. S.) aus. In Österreich wurde die S.-Tradition v. a. von jenen Komponisten fortgesetzt, die sich kontinuierlich mit anderen traditionellen Formen wie Konzert, Sonate oder kammermusikalischen Gattungen beschäftigten (z. B. F. Dallinger, G. v. Einem, Philadelphia S. op. 28, 1960, Wiener S. op. 49, 1976; H. Eder, H. Erbse, K. Haidmayer, M. Rubin, K. Schiske, R. Schollum, A. Uhl, R. Weißensteiner), mitunter mit Anspielungen an die Schlüsselwerke der Musikgeschichte (I. Eröd, Erste Sinfonie „Aus der Alten Welt“ op. 67, 1995). Dabei lassen sich hier sowohl Anknüpfungen an große Besetzungen (K. Rapf: Dritte S. für Frauenchor [stark besetzt] und Orchester, 1986) als auch kleinere Formen (K. Schwertsik, Sinfonia – Sinfonietta. Fünf Sätze für Orchester op. 73, 1996; B. J. Schaeffer, Sinfonietta für 16 Instrumente, 1996) beobachten. Wie das 110-minütige Werk Sinfonia/Concerto für 15 Instrumentalsolisten und Orchester (1996) von Schaeffer jedoch belegt, müssen Besetzung und Länge des Werkes nicht unbedingt miteinander korrelieren. Gelegentlich wird die Bezeichnung S. im Sinne der barocken Tradition als „Sonata“ verwendet (K. Rapf, Orgel-S. Nr. 1, 1981/90; P. Kont, Eine Sinfonie in Dur, 1994, für 4 Cembali; P. Kont, S.n für Orgel, 1992; P. Angerer, Sinfonia, Wiegenlied und Tanz für Viola d’amore, Violine und Kontrabass [oder Vc.], 1993).
Literatur
MGG 12 (1965), 16 (1979) u. 9 (1998); NGroveD 24 (2001); MaÖ 1997; A. Heuss in SIMG 4 (1902/03); H. Botstiber, Gesch. der Ouvertüre u. der freien Orchesterformen 1913; P. Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler 1918; J. Kucaba, The Symphonies of Georg Christoph Wagenseil, Diss. Boston 1967; P. H. Lang (Hg.), The Symphony 1800–1900, 1969; H. Hell, Die neapolitanische Opernsinfonie in der 1. Hälfte des 18. Jh.s 1971; C. Floros in Brahms-Studien 1 (1974); C. Floros, Mahler und die Symphonik des 19. Jh.s in neuer Deutung 1977, 21987; J. P. Larsen in Haydn Yearbook 1978; E. K. Wolf in R. Würtz (Hg.), [Kgr.-Ber.] Mannheim und Italien – Zur Vorgesch. der Mannheimer. Mannheim 1982, 1984; M. Gervink, Die S. in Deutschland und Österreich in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 1984; N. Zaslaw, Mozart’s Symphonies: Context, Performance Practice, Reception 1989; St. Kunze, Die Sinfonie im 18. Jh. 1993, 157–192; J. P. Larsen in StMw 43 (1994); W. Gersthofer in Mozart Studien 5 (1995); W. Frisch, Brahms. The Four Symphonies 1996; MGÖ 1–3 (1995); O. Wessely (Hg.), [Kgr.-Ber.] Die österr. S. nach Bruckner. Linz 1981, 1983; W. Steinbeck/Ch. v. Blumröder, Die S. im 19. und 20. Jh. 2002.
MGG 12 (1965), 16 (1979) u. 9 (1998); NGroveD 24 (2001); MaÖ 1997; A. Heuss in SIMG 4 (1902/03); H. Botstiber, Gesch. der Ouvertüre u. der freien Orchesterformen 1913; P. Bekker, Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler 1918; J. Kucaba, The Symphonies of Georg Christoph Wagenseil, Diss. Boston 1967; P. H. Lang (Hg.), The Symphony 1800–1900, 1969; H. Hell, Die neapolitanische Opernsinfonie in der 1. Hälfte des 18. Jh.s 1971; C. Floros in Brahms-Studien 1 (1974); C. Floros, Mahler und die Symphonik des 19. Jh.s in neuer Deutung 1977, 21987; J. P. Larsen in Haydn Yearbook 1978; E. K. Wolf in R. Würtz (Hg.), [Kgr.-Ber.] Mannheim und Italien – Zur Vorgesch. der Mannheimer. Mannheim 1982, 1984; M. Gervink, Die S. in Deutschland und Österreich in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 1984; N. Zaslaw, Mozart’s Symphonies: Context, Performance Practice, Reception 1989; St. Kunze, Die Sinfonie im 18. Jh. 1993, 157–192; J. P. Larsen in StMw 43 (1994); W. Gersthofer in Mozart Studien 5 (1995); W. Frisch, Brahms. The Four Symphonies 1996; MGÖ 1–3 (1995); O. Wessely (Hg.), [Kgr.-Ber.] Die österr. S. nach Bruckner. Linz 1981, 1983; W. Steinbeck/Ch. v. Blumröder, Die S. im 19. und 20. Jh. 2002.
Autor*innen
Dagmar Glüxam
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2006
Empfohlene Zitierweise
Dagmar Glüxam,
Art. „Symphonie (Sinfonie)‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2006, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e415
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.